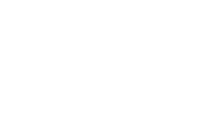Man liest kein fremdes Tagebuch
Musikalische Komödie
Musik von Conny Odd
Text von Maurycy Janowski
Inszenierung
Uraufführung: 19. April 1974
Metropol-Theater Berlin, DDR
- Musikalische Leitung: Werner Krumbein
- Regie: Hans Pitra
- Bühnenbild: Manfred Bitterlich
- Kostüme: Waltraud Gantz
- Choreographie: Helga Wasmer-Witt
- Chöre: Karl-Heinz Rosenbusch
Besetzung:
- Anna Kern, Studentin der Soziologie: Gertraude Wagner
- Hans Jedermann, Betonfacharbeiter: Fritz Hille
- Jochen Holzmacher, Brigadier: Gert Böhme
- Benno, Mitglied der Brigade Holzmacher: Wolfgang Ostberg
- Liebling, Mitglied der Brigade Holzmacher: Wolfgang Eilers
- Frontal, Mitglied der Brigade Holzmacher: Erich Kiefel
- Konter, Mitglied der Brigade Holzmacher: Paul Arenkens
- Julchen, Studentin: Doris Abesser
- Anita, Studentin: Sigrid Olischer
- Doktor: Hans Recknagel
- Schwester: Susanne Leiterer
- Der Minister: Hans Glogowski
- Mathematiker: Detlev Dathe
- Der Kollege, der die Honneurs macht: Karl-Heinz Sernatinger
- Weitere Studentinnen und Brigademitglieder: Ch. Brose, E.-M. Budde, K. Howitz, R. Pawlicek, S. Raulin, R. Scherfling, H. Sommer, R. Voigt, G. Schmidt, W. Abrolat, W. Klein, H. Lindner, W. Pohle, G. Schicker, R. Stujke, K.-D. Engels, H. Ehrhardt
- Ballettsolisten: Helga Dürr, Hildegard Hoffmann, Maria Sierakowski, Eveline Lützow, Wolfgang Appenheimer, Lothar Butzies, Helmut Schindler
- Tanzdouble in den Bildern 5, 9 und 14: Karin Münch, Helmut Schindler
|
|
|
Gertraude Wagner (als Anna Kern) (c) Deutsche Fotothek / Foto: Abraham Pisarek |
Premierenchronik
| DDR | UA | 19. April 1974 | Metropol-Theater, Berlin |
Inhaltsangabe
"Der Hypochonder Hans Jedermann hat panische Angst vor Bazillen und Viren. Er fühlt sich bereits krank, wenn er nur etwas von einer Krankheit hört. Sein Arbeitskollege Benno, Betonfacharbeiter wie er, der sich für einen Wunderdoktor hält - grundsätzlich studierte Mediziner ablehnt - hat in dem Hypochonder Hans Jedermann ein bereitwilliges Opfer gefunden. Während einer Untersuchung erlauschten Hans Jedermann und Benno ein lateinisches Wort, das Benno für die Bezeichnung einer lebensbedrohlichen Krankheit hält - in Wahrheit ist der Gattungsbegriff für eine Pflanze - dadurch glaubt sich Hans Jedermann todsterbenskrank, er resigniert.
Doch plötzlich bricht er aus dieser resignierenden Haltung heraus und wird aktiv. Den Hauptanstoß zu dieser plötzlichen Haltungsveränderung gibt die Soziologiestudentin Anna. Sie lieben sich, wenn sie sich das auch anfänglich überhaupt nicht eingestehen wollen. Je größer die Liebe wird, desto größer werden seine Taten! Er will sich ein Denkmal bei Anna und seinen Kollegen setzen. In seiner eigenbrödlerischen und eigenwilligen Art schafft er verbissen daran. Er führt seine technische Neuerung zu Ende und erzielt damit einen großen Arbeitserfolg. Sowohl der Nutzen für die Gesellschaft als auch seine Liebe werden belohnt: von der Gesellschaft mit Anerkennung und von der Anna mit einem Kuß, der ein langes Leben anhalten wird."
(aus: Broschüre "Premiere im Metropol", Berlin, 1974)
|
|
|
v.l.: Gert Böhme (als Brigadier Jochen Holzmacher), Fritz Hille (als Hans Jedermann), Ensemble (c) Deutsche Fotothek / Foto: Abraham Pisarek |
Kritiken
"Eigentlich liest man ja kein fremdes Tagebuch. Hier aber ist solche Indiskretion höchst nötig. Sie allein führt zum glücklichen Ende. Aus dem Tagebuch erfährt Anna, was sie so gern wissen möchte: Daß Hans sie liebt.
´Man liest kein fremdes Tagebuch´ heißt also die neue ´Musikalische Komödie´ von Maurycy Janowski (Libretto) und Conny Odd (Musik), mit der das Metropol-Theater seine ´Woche des DDR-Musicals´ abschloß. Ein Gegenwartsstück, hier und heute, unter Bauarbeitern und Studentinnen der Hauptstadt spielend. Reizvoll dabei der Versuch, die dramaturgische Konzeption ein wenig abseits vom bekannten Klischee des neueren, heiteren Musiktheaters anzusiedeln: Das Ganze läuft als eine Art Rückblende ab. Anna erzählt, was sie im Tagebuch fand, und der Zuschauer hört und sieht danach, wie sich bestimmte Ereignisse in der Begegnung zwischen Hans und Anna abgespielt haben, wie beide - und ihre Umgebung - ohne Kenntnis des Tagebuches reagierten. Freilich: Im Verlaufe des Abends nutzt sich diese dramaturgische Technik zusehends ab, wird ein wenig zerredet und nur durch musikalischen wie szenischen Aufputz hochgepäppelt.
Conny Odd hat eine sauber gearbeitete, wirkungssichere, alles in allem freilich nicht sonderlich inspirierende Musik dazu geschrieben."
Hansjürgen Schaefer: Eigentlich liest man kein fremdes Tagebuch, Zur Uraufführung im Berliner Metropol-Theater. In: Neues Deutschland, Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Nr. 111, 23. April 1974.
"Die Uraufführung dieses Auftragswerkes des Berliner Metropol wurde vom Hausherrn Hans Pitra selbst mit viel Umsicht und Gespür für die Möglichkeiten des Stoffes vom Regiepult aus umgesetzt.
In mancher Hinsicht bedeutet das Musical einen Fortschritt: Sozialistische Umwelt, in diesem Falle Berliner Bauarbeitermilieu an der Leipziger Straße, wird recht treffend und witzig eingefangen. Die Ensembles zu Beginn haben Originalität: ´So sind wir´, womit sich Bauleute (´rauh und lässig´) und zu ihnen als Ferienhelfer kommende kesse Studentinnen (´Der Kopf ist nicht nur für den Hut da´) vorstellen.
Leider bleibt das mehr oder minder Kulisse. Die eigentliche Story aber stammt aus der alten Schwankkiste. [...]
Nicht sonderlich gut beraten waren die Schöpfer mit der auf die Dauer penetranten Rahmenhandlung, die die Hans´ Tagebuch lesende Anna allein durchzustehen hat.
Conny Odd ist, im besten wie im nicht so guten Sinne, ein Routinier dieses Genres. Bei den genannten Höhepunkten ist er immer groß da, weiß poetische Glanzlichter in Chansonmanier zu setzen, ist aber in der Ouvertüre und in Zwischenspielen allzu konventionell-unverbindlich, übertreibt manchmal auch ein bißchen die Rückungen. Werner Krumbein hat sich des Werkes kenntnisreich angenommen, wenngleich zum Teil mehr Verfeinerung denkbar wäre."
Werner Schönsee: Eine feurig-kühle Komödie. In: Neue Zeit, Zentralorgan der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Nr. 110, 11. Mai 1974.
"Gewiß, es gibt durchaus komische Momente, doch sind nicht wenige von ihnen in erster Lini verbaler Natur - ´sehr komisch´ ist das Ganze jedenfalls nicht. ´Sehr dramatisch´ auch nicht. Wiewohl im Grundeinfall sich durchaus Dramatisches ankündigt, das im Buch dann jedoch nach Herzenslust verwässert (oder soll ich sagen: verzuckert?) erscheint.
[...] Ich wollte andeuten, was mir am Stück fehlt: ein lebensechtes Erfassen und Gestalten der angerissenen Problematik, mehr Konzentration auf das wesentliche, auf das Anliegen. Mithin auch eine glaubhaftere Zeichnung der Figuren, vor allem der männlichen.
[...] Conny Odds farbig instrumentierte Musik geht von der Situation aus und hat dabei insbesondere im Rhythmisch-Tänzerischen ihre starke Seite."
Hans-Gerald Otto: Maßvolles Vergnügen, Zur Uraufführung "Man liest kein fremdes Tagebuch" am Metropol-Theater. In: Theater der Zeit, Heft 7, 1974, Seite 18-20.
|
|
|
v.l.: Doris Ambesser (als Julchen), Gertraude Wagner (als Anna Kern) (c) Deutsche Fotothek / Foto: Abraham Pisarek |
Medien / Publikationen
Literatur
- Jost Lehne: Der Admiralspalast, Die Geschichte eines Berliner "Gebrauchs"-Theaters. Berlin: be.bra 2006.
Kommentar
Mit der Uraufführung von "Man liest kein fremdes Tagebuch" endete die "Woche des DDR-Musicals", die vom Metropol-Theater organisiert worden war. Sieben zeitgenössische Musicals aus der Feder von DDR-Autoren standen auf dem Programm der Bühne. Angereist waren die Repräsentanten der Operettenbühnen in Moskau, Leningrad, Warschau, Sofia, Bukarest, Budapest und Bratislava.
Empfohlene Zitierweise
"Man liest kein fremdes Tagebuch". In: Musicallexikon. Populäres Musiktheater im deutschsprachigen Raum 1945 bis heute. Herausgegeben von Wolfgang Jansen und Klaus Baberg in Verbindung mit dem Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. www.musicallexikon.eu
Letzte inhaltliche Änderung: 15. Januar 2025.